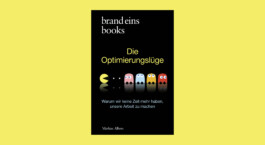
Digitale Tools, endlose Meetings, KI-Experimente: In vielen Teams ist der Arbeitsalltag zu einem Dauerprojekt geworden – mit zweifelhafter Bilanz. Der Journalist und Kommunikationsberater Markus Albers sagt: Es reicht. In seinem Buch rechnet er mit den Versprechen moderner Arbeitskultur ab und zeigt, wie Arbeit wieder menschlicher, produktiver und sinnvoller werden kann. Ein Interview mit Markus Albers.
Herr Albers, endlose Meetings, überladene Projekt-Tools – viele in der Kreativbranche fühlen sich mehr als Prozess-Manager, denn als Kreative. Ist das der sogenannte „Prozessionismus“, den Sie beschreiben, und warum trifft er gerade Agenturen so?
Wir haben uns von den Fesseln an die Schreibtische befreit, aber die Arbeit sickert dafür noch in die letzten Lebensbereiche ein. Der unerbittliche Takt der Prozesse nimmt uns jeden Moment des Innehaltens und Nachdenkens.
Wissensarbeiterinnen verbringen inzwischen fast sechzig Prozent ihrer Zeit mit Kommunikationswerkzeugen, aber nur vierzig Prozent mit Kreations-Software. Die Zahl der Meetings hat im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie um das Zweieinhalbfache zugenommen. Eine Mehrheit der Arbeitnehmenden hat nicht genug Zeit und Energie, um ihre Arbeit zu erledigen – und findet es zunehmend schwer, innovativ zu sein oder strategisch zu denken. Führungskräfte spüren bereits die Auswirkungen und geben an, dass der Mangel an Innovation oder bahnbrechenden Ideen in ihren Teams ein Problem darstellt. Ich denke gar nicht, dass dieses Phänomen vor allem auf Agenturen zutrifft, denn es gilt für alle Wissensarbeitenden, also Menschen, die hauptsächlich mit Kopf und Computer arbeiten. Aber vermutlich sind die Auswirkungen bei Agenturen beispielhaft zu beobachten.
Agenturen nutzen viele Tools für mehr Effizienz. Wie schaffen wir es, dass Notion, Asana & Co. wirklich zu smarten Helfern werden und nicht zu digitalen Zeitfressern, die uns von der kreativen Arbeit abhalten?
Der US-amerikanische Forscher Cal Newport spricht von einer Great Exhaustion von Wissensarbeitenden, empfiehlt weniger Kollaboration und mehr konzentrierte Arbeit. Das ist richtig, das habe ich auch schon oft beschrieben. Aber es greift zu kurz. Denn das Problem liegt ja tiefer. Die monotone Produktivitätsspirale der Tools lässt sich nur durchbrechen, wenn wir es schaffen, unseren Arbeitsalltag grundsätzlich anders zu strukturieren. Einen Ansatz dazu liefert der Autor Seth Godin mit dem, was er shipping nennt – ein Begriff, der ins Deutsche nur unzulänglich mit ausliefern zu übersetzen ist: „Was nicht ausgeliefert wird, zählt nicht“, so Godin: „Was nicht kreativ produktiv ist, ist nicht hilfreich. Wenn wir Glück haben, ist dies das Herzstück unserer Arbeit: Die Arbeit der Schöpfung in dem von uns gewählten Medium.” Denn das Gefühl, etwas geschaffen und geschafft zu haben, erfüllt mit Zufriedenheit. Handwerker haben eine deutlich höhere Jobzufriedenheit als der Durchschnitt der Arbeitnehmenden – 80 Prozent bezeichnen sich als glücklich mit ihrer Arbeit, in der Gesamtbevölkerung sagen das nur 55 Prozent. Ein Grund: Handwerk schafft sichtbare, abgeschlossene Arbeitsergebnisse. „Man tut etwas, das jemand braucht und das man am Ende wirklich sehen kann”, so die Glücksforscherin Ricarda Rehwaldt. Dachdecker lachen nur über Great Resignation und Quiet Quitting.
Sie beschreiben KI als kreativen Sparringspartner. Welches Potenzial sehen Sie, wenn KI repetitive Routineaufgaben übernimmt? Wie kann das Freiräume für strategischere und kreativere Arbeit schaffen, die am Ende allen zugutekommt?
KI hat das Potenzial, Menschen von der digitalen Überlastung zu befreien. „Ich bitte meinen Bot, eine lange Einladung an mein Team mit einer Meeting-Agenda zu formulieren”, nennt der Autor und Brand Eins-CEO Holger Volland ein Beispiel: „Deren Bot liest sie, fasst sie kurz zusammen und sagt automatisch zu.” Solche Automatisierung von zeitraubenden Routineaufgaben nennt er KI-generierte Gebrauchsinhalte. Diese seien das ideale Tool für internationale Teams und „jene Aufgaben, die zeitlich und räumlich verteilt diversifiziert bearbeitet werden.” Also zunehmend: sehr viele. Microsoft spricht sogar davon, dass KI „Arbeit reparieren” könne, was ja impliziert, dass unsere heutige Arbeitsweise defekt ist. Sowohl für überforderte Mitarbeiter als auch für Führungskräfte, die die Produktivität steigern wollen, sei dieses Versprechen überfällig. Im Ergebnis entstehe mehr Wertschöpfung für Unternehmen und nicht weniger als „eine bessere, erfüllendere Zukunft der Arbeit für alle.” Der kritische Journalist in mir hat da einige Fragen, denn das Ganze ist natürlich vor allem eine Verkaufsmaßnahme für Microsofts KI-Produkte wie CoPilot. Aber selbst wenn nur die Hälfte der erhofften Verbesserungen einträte, wäre das ein vielversprechender Ausweg aus der heute vorherrschenden Arbeitsweise.
Starke Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen. Wie können Agenturen ihre Kunden partnerschaftlich mit auf die Reise nehmen, um den Fokus von reinen Prozess-Reportings auf das gemeinsame Ziel zu lenken? Brauchen wir eine neue Art von Kundenbeziehung?
Ich glaube: In einer Welt, in der austauschbare KI-Inhalte immer mehr Raum einnehmen, braucht es maßgeschneiderte und diskrete Kommunikationsberatung. Je mehr manche Agenturen versuchen, nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Kreation von Content und Kampagnen zu automatisieren – mit den entsprechenden Reporting-Orgien –, wünschen sich Kunden als Gegengwicht den persönlichen Kontakt, das vertrauensvolle Gespräch, außergewöhnliche Geschichten, die individuelle menschliche Perspektive mit all ihren Widersprüchen und Idiosynkrasien. Das ist kein Widerspruch, sondern das werden zwei Seiten einer Medaille werden: In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden die Algorithmen viel unter sich ausmachen. Aber es wird umso mehr Platz für die kleine, feine Advisory geben.
Die 4-Tage-Woche klingt verlockend, aber in einer Branche, die von Kunden-Deadlines und spontanen Pitches lebt, für viele utopisch. Ist das nur ein Privileg für wenige oder haben Sie einen Tipp, wie Agenturen diesen Spagat schaffen können?
Ich sehe die Hürden, aber ich habe es trotzdem gemacht – sogar während meiner Zeit als festangestellte Führungskraft in einer Agentur. Mehrere Jahre lang hatte ich – mit Unterbrechungen, wenn einfach zu viel zu tun war – eine 4-Tage-Woche. Warum? Erstens bin ich davon überzeugt, dass es geht. Viele Eltern kleiner Kinder – und, man muss sagen: leider sind es heute oft noch die Frauen – schaffen es, auch in Teilzeit Verantwortung zu tragen und exzellente Arbeit abzuliefern. Auch hoch qualifizierte und verantwortungsvolle Rollen kann man mit reduzierter Arbeitszeit ausfüllen, wenn man sich ordentlich organisiert. Zweitens kann ich so meinen kleinen Beitrag zu einem wichtigen gesellschaftlichen Wandel leisten. Eine 4-Tage-Woche bringt mehr Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, denn sie hilft, unbezahlte Haus- und Familien-Arbeit fairer zwischen den Geschlechtern aufzuteilen – das ist gut belegt. Drittens – und da sind wir bei unserem Thema –, bin ich sicher, dass eine 4-Tage-Woche die Qualität meiner Arbeit verbessert. Denn sie erlaubt mir, zumindest an einem Tag pro Woche dem gnadenlosen Takt der digitalen Workflows und der oft pseudoproduktiven Toolbefüllung des Prozessionismus zu entkommen. An diesem Tag merke ich, wie sich Arbeit eben auch anfühlen kann: Mal schnell, mal langsam. Mal am Bildschirm, mal nicht. Mit Phasen des Flow und Momenten der Kontemplation. Mit Sport zwischendurch und dann wieder extremer Konzentration. Ich fühle mich an diesen Tagen kreativer, produktiver – und glücklicher, weil ich abends etwas geschafft und oft sogar geschaffen habe.
Stellen wir uns vor, jemand liest dieses Interview und fühlt sich bei vielen Antworten ertappt. Was wäre Ihr ganz konkreter, ermutigender erster Schritt, den jeder von uns morgen tun kann, um aus der eigenen Optimierungsfalle auszubrechen?
Das Thema im Team, unter Kollegen und Vorgesetzten – und sogar bei Kunden – offen ansprechen. Viele haben Angst, dass ihnen das als Schwäche ausgelegt wird. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Meist, so meine Erfahrung, geht es den anderen genauso. Ist dieser Konsens einmal erreicht, kann man gemeinsam an praktischen Lösungen arbeiten. Mein erster Tipp wäre: Alle Meetings auf den Prüfstand stellen. Wir haben viel zu viele Jour Fixes und Check-Ins. Ich behaupte: Mindestens die Hälfte kann weg, wenn wir konsequent asynchron arbeiten. Das schafft dann schon mal eine Menge Platz im Kalender.
Wer tiefer einsteigen möchte, dem empfehlen wir das Buch von Markus Albers. Hier erhältlich: Brand Eins oder Amazon

Markus Albers, Journalist und Kommunikationsberater, beleuchtet die Schattenseiten der modernen Arbeitskultur. In seinem Buch „Die Optimierungslüge” zeigt er, wie der digitale Optimierungsdrang Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit erstickt – und wie befreiende Alternativen aussehen können.
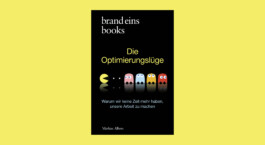
Digitale Tools, endlose Meetings, KI-Experimente: In vielen Teams ist der Arbeitsalltag zu einem Dauerprojekt geworden – mit zweifelhafter Bilanz. Der Journalist und Kommunikationsberater Markus Albers sagt: Es reicht. In seinem Buch rechnet er mit den Versprechen moderner Arbeitskultur ab und zeigt, wie Arbeit wieder menschlicher, produktiver und sinnvoller werden kann. Ein Interview mit Markus Albers.
Herr Albers, endlose Meetings, überladene Projekt-Tools – viele in der Kreativbranche fühlen sich mehr als Prozess-Manager, denn als Kreative. Ist das der sogenannte „Prozessionismus“, den Sie beschreiben, und warum trifft er gerade Agenturen so?
Wir haben uns von den Fesseln an die Schreibtische befreit, aber die Arbeit sickert dafür noch in die letzten Lebensbereiche ein. Der unerbittliche Takt der Prozesse nimmt uns jeden Moment des Innehaltens und Nachdenkens.
Wissensarbeiterinnen verbringen inzwischen fast sechzig Prozent ihrer Zeit mit Kommunikationswerkzeugen, aber nur vierzig Prozent mit Kreations-Software. Die Zahl der Meetings hat im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie um das Zweieinhalbfache zugenommen. Eine Mehrheit der Arbeitnehmenden hat nicht genug Zeit und Energie, um ihre Arbeit zu erledigen – und findet es zunehmend schwer, innovativ zu sein oder strategisch zu denken. Führungskräfte spüren bereits die Auswirkungen und geben an, dass der Mangel an Innovation oder bahnbrechenden Ideen in ihren Teams ein Problem darstellt. Ich denke gar nicht, dass dieses Phänomen vor allem auf Agenturen zutrifft, denn es gilt für alle Wissensarbeitenden, also Menschen, die hauptsächlich mit Kopf und Computer arbeiten. Aber vermutlich sind die Auswirkungen bei Agenturen beispielhaft zu beobachten.
Agenturen nutzen viele Tools für mehr Effizienz. Wie schaffen wir es, dass Notion, Asana & Co. wirklich zu smarten Helfern werden und nicht zu digitalen Zeitfressern, die uns von der kreativen Arbeit abhalten?
Der US-amerikanische Forscher Cal Newport spricht von einer Great Exhaustion von Wissensarbeitenden, empfiehlt weniger Kollaboration und mehr konzentrierte Arbeit. Das ist richtig, das habe ich auch schon oft beschrieben. Aber es greift zu kurz. Denn das Problem liegt ja tiefer. Die monotone Produktivitätsspirale der Tools lässt sich nur durchbrechen, wenn wir es schaffen, unseren Arbeitsalltag grundsätzlich anders zu strukturieren. Einen Ansatz dazu liefert der Autor Seth Godin mit dem, was er shipping nennt – ein Begriff, der ins Deutsche nur unzulänglich mit ausliefern zu übersetzen ist: „Was nicht ausgeliefert wird, zählt nicht“, so Godin: „Was nicht kreativ produktiv ist, ist nicht hilfreich. Wenn wir Glück haben, ist dies das Herzstück unserer Arbeit: Die Arbeit der Schöpfung in dem von uns gewählten Medium.” Denn das Gefühl, etwas geschaffen und geschafft zu haben, erfüllt mit Zufriedenheit. Handwerker haben eine deutlich höhere Jobzufriedenheit als der Durchschnitt der Arbeitnehmenden – 80 Prozent bezeichnen sich als glücklich mit ihrer Arbeit, in der Gesamtbevölkerung sagen das nur 55 Prozent. Ein Grund: Handwerk schafft sichtbare, abgeschlossene Arbeitsergebnisse. „Man tut etwas, das jemand braucht und das man am Ende wirklich sehen kann”, so die Glücksforscherin Ricarda Rehwaldt. Dachdecker lachen nur über Great Resignation und Quiet Quitting.
Sie beschreiben KI als kreativen Sparringspartner. Welches Potenzial sehen Sie, wenn KI repetitive Routineaufgaben übernimmt? Wie kann das Freiräume für strategischere und kreativere Arbeit schaffen, die am Ende allen zugutekommt?
KI hat das Potenzial, Menschen von der digitalen Überlastung zu befreien. „Ich bitte meinen Bot, eine lange Einladung an mein Team mit einer Meeting-Agenda zu formulieren”, nennt der Autor und Brand Eins-CEO Holger Volland ein Beispiel: „Deren Bot liest sie, fasst sie kurz zusammen und sagt automatisch zu.” Solche Automatisierung von zeitraubenden Routineaufgaben nennt er KI-generierte Gebrauchsinhalte. Diese seien das ideale Tool für internationale Teams und „jene Aufgaben, die zeitlich und räumlich verteilt diversifiziert bearbeitet werden.” Also zunehmend: sehr viele. Microsoft spricht sogar davon, dass KI „Arbeit reparieren” könne, was ja impliziert, dass unsere heutige Arbeitsweise defekt ist. Sowohl für überforderte Mitarbeiter als auch für Führungskräfte, die die Produktivität steigern wollen, sei dieses Versprechen überfällig. Im Ergebnis entstehe mehr Wertschöpfung für Unternehmen und nicht weniger als „eine bessere, erfüllendere Zukunft der Arbeit für alle.” Der kritische Journalist in mir hat da einige Fragen, denn das Ganze ist natürlich vor allem eine Verkaufsmaßnahme für Microsofts KI-Produkte wie CoPilot. Aber selbst wenn nur die Hälfte der erhofften Verbesserungen einträte, wäre das ein vielversprechender Ausweg aus der heute vorherrschenden Arbeitsweise.
Starke Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen. Wie können Agenturen ihre Kunden partnerschaftlich mit auf die Reise nehmen, um den Fokus von reinen Prozess-Reportings auf das gemeinsame Ziel zu lenken? Brauchen wir eine neue Art von Kundenbeziehung?
Ich glaube: In einer Welt, in der austauschbare KI-Inhalte immer mehr Raum einnehmen, braucht es maßgeschneiderte und diskrete Kommunikationsberatung. Je mehr manche Agenturen versuchen, nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Kreation von Content und Kampagnen zu automatisieren – mit den entsprechenden Reporting-Orgien –, wünschen sich Kunden als Gegengwicht den persönlichen Kontakt, das vertrauensvolle Gespräch, außergewöhnliche Geschichten, die individuelle menschliche Perspektive mit all ihren Widersprüchen und Idiosynkrasien. Das ist kein Widerspruch, sondern das werden zwei Seiten einer Medaille werden: In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden die Algorithmen viel unter sich ausmachen. Aber es wird umso mehr Platz für die kleine, feine Advisory geben.
Die 4-Tage-Woche klingt verlockend, aber in einer Branche, die von Kunden-Deadlines und spontanen Pitches lebt, für viele utopisch. Ist das nur ein Privileg für wenige oder haben Sie einen Tipp, wie Agenturen diesen Spagat schaffen können?
Ich sehe die Hürden, aber ich habe es trotzdem gemacht – sogar während meiner Zeit als festangestellte Führungskraft in einer Agentur. Mehrere Jahre lang hatte ich – mit Unterbrechungen, wenn einfach zu viel zu tun war – eine 4-Tage-Woche. Warum? Erstens bin ich davon überzeugt, dass es geht. Viele Eltern kleiner Kinder – und, man muss sagen: leider sind es heute oft noch die Frauen – schaffen es, auch in Teilzeit Verantwortung zu tragen und exzellente Arbeit abzuliefern. Auch hoch qualifizierte und verantwortungsvolle Rollen kann man mit reduzierter Arbeitszeit ausfüllen, wenn man sich ordentlich organisiert. Zweitens kann ich so meinen kleinen Beitrag zu einem wichtigen gesellschaftlichen Wandel leisten. Eine 4-Tage-Woche bringt mehr Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, denn sie hilft, unbezahlte Haus- und Familien-Arbeit fairer zwischen den Geschlechtern aufzuteilen – das ist gut belegt. Drittens – und da sind wir bei unserem Thema –, bin ich sicher, dass eine 4-Tage-Woche die Qualität meiner Arbeit verbessert. Denn sie erlaubt mir, zumindest an einem Tag pro Woche dem gnadenlosen Takt der digitalen Workflows und der oft pseudoproduktiven Toolbefüllung des Prozessionismus zu entkommen. An diesem Tag merke ich, wie sich Arbeit eben auch anfühlen kann: Mal schnell, mal langsam. Mal am Bildschirm, mal nicht. Mit Phasen des Flow und Momenten der Kontemplation. Mit Sport zwischendurch und dann wieder extremer Konzentration. Ich fühle mich an diesen Tagen kreativer, produktiver – und glücklicher, weil ich abends etwas geschafft und oft sogar geschaffen habe.
Stellen wir uns vor, jemand liest dieses Interview und fühlt sich bei vielen Antworten ertappt. Was wäre Ihr ganz konkreter, ermutigender erster Schritt, den jeder von uns morgen tun kann, um aus der eigenen Optimierungsfalle auszubrechen?
Das Thema im Team, unter Kollegen und Vorgesetzten – und sogar bei Kunden – offen ansprechen. Viele haben Angst, dass ihnen das als Schwäche ausgelegt wird. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Meist, so meine Erfahrung, geht es den anderen genauso. Ist dieser Konsens einmal erreicht, kann man gemeinsam an praktischen Lösungen arbeiten. Mein erster Tipp wäre: Alle Meetings auf den Prüfstand stellen. Wir haben viel zu viele Jour Fixes und Check-Ins. Ich behaupte: Mindestens die Hälfte kann weg, wenn wir konsequent asynchron arbeiten. Das schafft dann schon mal eine Menge Platz im Kalender.
Wer tiefer einsteigen möchte, dem empfehlen wir das Buch von Markus Albers. Hier erhältlich: Brand Eins oder Amazon

Markus Albers, Journalist und Kommunikationsberater, beleuchtet die Schattenseiten der modernen Arbeitskultur. In seinem Buch „Die Optimierungslüge” zeigt er, wie der digitale Optimierungsdrang Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit erstickt – und wie befreiende Alternativen aussehen können.