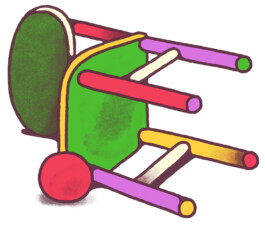Richtig dumm gelaufen
Etwas ungeschickt sind wir doch alle mal. Aber unsere Autorin setzt einen drauf und lernt die hohe Kunst der Tollpatschigkeit in einem absolut seriösen Clownsworkshop.
Versuchsobjekt:
Sandra Winkler, die eigentlich keinen Spaß versteht,
sobald Clowns beteiligt sind
Testumgebung:
Ein dreitägiges Clowns-Seminar in Berlin
Mission:
Gekonnt ins Straucheln kommen
Illustrationen:
Caspar David Engstfeld
Alles in mir sträubt sich. Und vor Aufregung ist mir übel. Ich will das hier nicht machen! „Clowns-Erwachen“ heißt die Aufgabe, die die Dozentin gestellt hat. Nacheinander sollen wir sieben Workshop-Teilnehmer folgendes schaffen: vor allen anderen auf einem Stuhl sitzen, dann hinter vorgehaltener Hand eine rote Nase aufziehen und so tun, als würde man kurz einnicken – um beim Aufwachen zu entdecken: Ich bin ein Clown! Was bedeutet: ein naives Wesen, das nichts von der Welt weiß, also erst mal den eigenen Körper und den Raum erkunden muss. Ich bin noch lange nicht an der Reihe. Und mein Unbehagen wächst.
Meine Überlegung, diesen Lehrgang zu buchen, war: Normalerweise sind wir ja alle darauf bedacht, möglichst wenig Fehler zu machen. Bloß keine Fehltritte, bitte keine Peinlichkeiten. Geht dann doch mal etwas schief, und sei es, dass man über einen Bordstein stolpert: erst mal gucken, ob einer guckt. Kaum jemand, außer dem Clown, möchte, dass man über ihn lacht. Alles unter Kontrolle.
Dass ich nicht den eintägigen Mini-Workshop gebucht habe, sondern gleich den Drei-Tage-Kurs bei Sirkka Remes, einer in Berlin lebenden Finnin und ausgebildeten Schauspielerin mit 20-jähriger Clownserfahrung … das war von mir geradezu naiv. Denn ich mag keine Clowns. Ihre Nummern finde ich selten witzig, meistens langatmig, die Gags sind mir zu erwartbar, die Figuren zu dümmlich.
Allein schon den anderen bei ihrem Clowns-Erweckungserlebnis zuzusehen, ist mir unangenehm. Erstaunt untersuchen sie ausgiebig ihre Hände und Füße, schauen mit aufgerissenen Augen im leeren Raum herum. Eine Rotnasenträgerin fällt erst einmal vom Stuhl, natürlich. Die andere setzt sich falsch herum drauf und bekommt beim Aufstehen das Bein nicht über die Lehne. Ein anderer verzweifelt minutenlang daran, den umgefallenen Stuhl wieder richtig hinzustellen.

Dass ich das nicht lustig finde, ist die eine Sache. Es dann selbst zu machen, die andere. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwerfallen würde, mich beim Blödanstellen möglichst gut anzustellen. Wie gern würde ich jetzt einen Gag einstudieren, jonglieren lernen oder eine Choreographie. Da gäbe es ein Richtig oder Falsch. Ich könnte scheitern und es noch einmal versuchen. Aber nein: „Mime spielt man, Clown ist man“, sagt Sirkka. Wir sollen improvisieren, den Moment frei auskosten. Das klingt so gar nicht nach mir. Ich habe gern Kontrolle und einen Plan.
Na, mal gucken, ob da ein innerer Clown, eine spontane Komik in mir schlummert und zum Vorschein kommt. Let the show begin! Relativ spontan überlege ich mir eine Art Sporty-Spice-Nummer, lege mich rücklings über den Stuhl, komme bei jedem Atemzug schnarchend ein Stückchen hoch – bis ich aufrecht sitze. Ich strecke mich und bewundere, wie gewünscht, Hände und Füße. Dabei komme ich mir schnell blöd vor. Wie lange kann man vor Publikum seine Extremitäten anstarren? Ich möchte nicht so tun, als wäre ich langsam und dümmlich. Ich will schlagfertig und schnell sein. Ich versuche es mit Aktionismus und mache Dehnübungen: Die Füße hüftbreit aufgestellt, beuge ich mich nach unten, schaue mir durch die Beine, halte inne und starre ins Publikum. Jemand lacht! Hoppla, das ist ja nett! Ich stemme mich vorwärts gegen die Wand, um meine Waden zu dehnen, und schaue unter dem Arm hindurch ins Publikum. Wieder grinsen ein paar Leute. Kurze Zufriedenheit. Dann aber werde ich panisch: Was kann ich jetzt noch machen? Weil mir nichts Besseres einfällt, schaue ich durchs Fenster. „Was machen die Leute da draußen?“, fragt Sirkka. „Laufen“, sage ich. „Ich muss auch laufen.“ Wo kam das denn jetzt her? Ich renne los und ziehe übertreiben die Knie dabei hoch. Wieder ein paar Lächler. Abrupt höre ich auf und verbeuge mich. Puh, endlich vorbei!
Die Kritik fällt milde aus: Ich soll mir mehr Zeit lassen. Aber die Blicke ins Publikum waren wohl ganz putzig, mein Gesicht hätte eine lustige Mimik, sehr clownesk, sagt eine andere Teilnehmerin. Ist das ein Kompliment?
In den nächsten Tagen geht es zum Beispiel um die Naivität des Clowns. Wir sollen den Gang anderer Teilnehmer nachahmen, absichtlich über einen Ball stolpern und ihm dann lange und verdutzt beim Wegrollen hinterherschauen. In einer anderen Übung sollen wir einen Gegenstand erkunden, so als wüssten wir nicht, was dieser ist. Zwischen meinen spielfreudigen Co-Clowns, die Hopser, Schlenker oder Grimassen einbauen, fühle ich mich überraschend steif. Ich möchte lieber nur Sirkkas Anweisungen schnell und korrekt ausführen – wäre aber gern spontaner, witziger, lockerer. Denn eigentlich dachte ich immer, ich sei extrovertiert und mir wäre kaum etwas peinlich. Zumindest mache ich mich im Alltag gern mal zum Deppen. Für einen Lacher setze ich mir im Hotel die Duschhaube auf oder ziehe an Halloween als Einhorn, dem es aus dem Auge blutet, durch die Straßen.
Aber hier, wo das Lustigsein eingefordert wird, fällt es mir schwer, die Übungen einfach laufen zu lassen, den Kopf abzuschalten. Das scheint vielen Menschen so zu gehen. Zumindest werden Clowns-Workshops oft als Selbsterfahrung gebucht oder Firmen schenken sie ihren Führungskräften, damit die sich mal locker machen, erzählt mir ein Teilnehmer. Er ist Psychotherapeut.
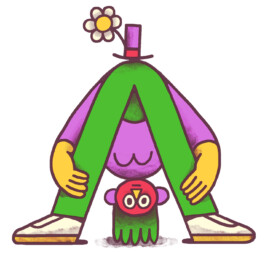
Tatsächlich gewöhne ich mich nach und nach daran, mich vor den anderen bloßzustellen. Vielleicht ist es die Nase, hinter der ich mich verstecken kann. Alles halb so schlimm, das bin ja nicht ich, das ist nur mein Clown. Oder der gesunkene Leistungsdruck – der Rest der Gruppe ist ja auch nicht lustiger. Außerdem versuche ich, mit meiner Clowns-Abneigung Frieden zu schließen, nachdem mir die anderen erzählt haben, warum sie diesen Kurs machen. Zu unserer Truppe gehört zum Beispiel eine Professorin, die schon ihr ganzes Leben lang den Wunsch hat, Clown zu sein. So richtig kann sie nicht aus ihrer Wissenschaftlerinnen-Haut: Vor dem Workshop hat sie sich Bücher zum Thema bestellt, unter anderem „Ansichten eines Clowns“ von Heinrich Böll. Ein Schauspieler und Erzieher will nach dem Tod seiner Frau sehen, ob er noch lachen kann. Eine junge Sozialwissenschaftlerin, die gerade an einer renommierten Clownsschule in der Schweiz abgelehnt wurde, möchte ihren Traum vom Clownsein einfach nicht aufgeben. Die Faszination der anderen rührt mich irgendwie.
Wäre es nicht lustig, überlege ich auf dem Weg zum letzten Workshop-Tag, als ich mit dem Fahrrad an einer Kreuzung auf Grün warte, wenn der Mann da vorn jetzt über die Straße hüpfen würde? Wir sind schon sehr versessen darauf, alles möglichst normal zu machen. Heute übt mein Kurs sich in Improvisation. Herausfordernd. Aber langsam bekomme ich sogar Spaß daran, komische Sachen zu machen und mich ungeschickt anzustellen.
Tage später wirken meine Clown-Erfahrungen nach. Mit einer Freundin sitze ich auf einem rummeligen Platz im Café und wir beobachten die Leute. Eine junge Frau läuft ungelenk auf ihren Plateau-Flip-Flops an uns vorbei. Ihre Jeans hat sie der Länge nach in vier Streifen pro Bein geschnitten, die nun wie diese Wischlappen in der Autowaschanlage um sie herumschwingen. Kein schlechtes Clownskostüm, finden wir. Ein älterer Mann trägt seine Haare exakt gescheitelt, auf der einen Seite silber, auf der anderen schwarz, dazu eine schwarz-weiß karierte Hose. Ernsthaft? Das sieht schon ziemlich lustig aus.
Meine Laune steigt – und ich bin inspiriert. Am nächsten Tag setze ich meine Clownsnase auf und eine aufgeblasene Gummikrone und gehe so vor die Tür. Natürlich komme ich mir albern vor, aber nicht im professionellen Sinne. Eine Gruppe halbstarker Skater wartet auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Tram. Ich rechne damit, dass sie sich lustig über mich machen. Doch einer von ihnen winkt mir zu. Und ein Fahrradfahrer fährt an mir vorbei, grüßt grinsend und klingelt. Toll! So eine Wirkung auf andere möchte ich immer haben. Vielleicht steckt ja doch ein Clown in mir – einer für den Alltag, nicht für die Bühne.
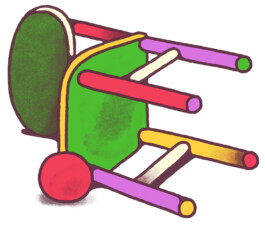

Richtig dumm gelaufen
Etwas ungeschickt sind wir doch alle mal. Aber unsere Autorin setzt einen drauf und lernt die hohe Kunst der Tollpatschigkeit in einem absolut seriösen Clownsworkshop.
Versuchsobjekt:
Sandra Winkler, die eigentlich keinen Spaß versteht,
sobald Clowns beteiligt sind
Testumgebung:
Ein dreitägiges Clowns-Seminar in Berlin
Mission:
Gekonnt ins Straucheln kommen
Illustrationen:
Caspar David Engstfeld
Alles in mir sträubt sich. Und vor Aufregung ist mir übel. Ich will das hier nicht machen! „Clowns-Erwachen“ heißt die Aufgabe, die die Dozentin gestellt hat. Nacheinander sollen wir sieben Workshop-Teilnehmer folgendes schaffen: vor allen anderen auf einem Stuhl sitzen, dann hinter vorgehaltener Hand eine rote Nase aufziehen und so tun, als würde man kurz einnicken – um beim Aufwachen zu entdecken: Ich bin ein Clown! Was bedeutet: ein naives Wesen, das nichts von der Welt weiß, also erst mal den eigenen Körper und den Raum erkunden muss. Ich bin noch lange nicht an der Reihe. Und mein Unbehagen wächst.
Meine Überlegung, diesen Lehrgang zu buchen, war: Normalerweise sind wir ja alle darauf bedacht, möglichst wenig Fehler zu machen. Bloß keine Fehltritte, bitte keine Peinlichkeiten. Geht dann doch mal etwas schief, und sei es, dass man über einen Bordstein stolpert: erst mal gucken, ob einer guckt. Kaum jemand, außer dem Clown, möchte, dass man über ihn lacht. Alles unter Kontrolle.
Dass ich nicht den eintägigen Mini-Workshop gebucht habe, sondern gleich den Drei-Tage-Kurs bei Sirkka Remes, einer in Berlin lebenden Finnin und ausgebildeten Schauspielerin mit 20-jähriger Clownserfahrung … das war von mir geradezu naiv. Denn ich mag keine Clowns. Ihre Nummern finde ich selten witzig, meistens langatmig, die Gags sind mir zu erwartbar, die Figuren zu dümmlich.
Allein schon den anderen bei ihrem Clowns-Erweckungserlebnis zuzusehen, ist mir unangenehm. Erstaunt untersuchen sie ausgiebig ihre Hände und Füße, schauen mit aufgerissenen Augen im leeren Raum herum. Eine Rotnasenträgerin fällt erst einmal vom Stuhl, natürlich. Die andere setzt sich falsch herum drauf und bekommt beim Aufstehen das Bein nicht über die Lehne. Ein anderer verzweifelt minutenlang daran, den umgefallenen Stuhl wieder richtig hinzustellen.

Dass ich das nicht lustig finde, ist die eine Sache. Es dann selbst zu machen, die andere. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwerfallen würde, mich beim Blödanstellen möglichst gut anzustellen. Wie gern würde ich jetzt einen Gag einstudieren, jonglieren lernen oder eine Choreographie. Da gäbe es ein Richtig oder Falsch. Ich könnte scheitern und es noch einmal versuchen. Aber nein: „Mime spielt man, Clown ist man“, sagt Sirkka. Wir sollen improvisieren, den Moment frei auskosten. Das klingt so gar nicht nach mir. Ich habe gern Kontrolle und einen Plan.
Na, mal gucken, ob da ein innerer Clown, eine spontane Komik in mir schlummert und zum Vorschein kommt. Let the show begin! Relativ spontan überlege ich mir eine Art Sporty-Spice-Nummer, lege mich rücklings über den Stuhl, komme bei jedem Atemzug schnarchend ein Stückchen hoch – bis ich aufrecht sitze. Ich strecke mich und bewundere, wie gewünscht, Hände und Füße. Dabei komme ich mir schnell blöd vor. Wie lange kann man vor Publikum seine Extremitäten anstarren? Ich möchte nicht so tun, als wäre ich langsam und dümmlich. Ich will schlagfertig und schnell sein. Ich versuche es mit Aktionismus und mache Dehnübungen: Die Füße hüftbreit aufgestellt, beuge ich mich nach unten, schaue mir durch die Beine, halte inne und starre ins Publikum. Jemand lacht! Hoppla, das ist ja nett! Ich stemme mich vorwärts gegen die Wand, um meine Waden zu dehnen, und schaue unter dem Arm hindurch ins Publikum. Wieder grinsen ein paar Leute. Kurze Zufriedenheit. Dann aber werde ich panisch: Was kann ich jetzt noch machen? Weil mir nichts Besseres einfällt, schaue ich durchs Fenster. „Was machen die Leute da draußen?“, fragt Sirkka. „Laufen“, sage ich. „Ich muss auch laufen.“ Wo kam das denn jetzt her? Ich renne los und ziehe übertreiben die Knie dabei hoch. Wieder ein paar Lächler. Abrupt höre ich auf und verbeuge mich. Puh, endlich vorbei!
Die Kritik fällt milde aus: Ich soll mir mehr Zeit lassen. Aber die Blicke ins Publikum waren wohl ganz putzig, mein Gesicht hätte eine lustige Mimik, sehr clownesk, sagt eine andere Teilnehmerin. Ist das ein Kompliment?
In den nächsten Tagen geht es zum Beispiel um die Naivität des Clowns. Wir sollen den Gang anderer Teilnehmer nachahmen, absichtlich über einen Ball stolpern und ihm dann lange und verdutzt beim Wegrollen hinterherschauen. In einer anderen Übung sollen wir einen Gegenstand erkunden, so als wüssten wir nicht, was dieser ist. Zwischen meinen spielfreudigen Co-Clowns, die Hopser, Schlenker oder Grimassen einbauen, fühle ich mich überraschend steif. Ich möchte lieber nur Sirkkas Anweisungen schnell und korrekt ausführen – wäre aber gern spontaner, witziger, lockerer. Denn eigentlich dachte ich immer, ich sei extrovertiert und mir wäre kaum etwas peinlich. Zumindest mache ich mich im Alltag gern mal zum Deppen. Für einen Lacher setze ich mir im Hotel die Duschhaube auf oder ziehe an Halloween als Einhorn, dem es aus dem Auge blutet, durch die Straßen.
Aber hier, wo das Lustigsein eingefordert wird, fällt es mir schwer, die Übungen einfach laufen zu lassen, den Kopf abzuschalten. Das scheint vielen Menschen so zu gehen. Zumindest werden Clowns-Workshops oft als Selbsterfahrung gebucht oder Firmen schenken sie ihren Führungskräften, damit die sich mal locker machen, erzählt mir ein Teilnehmer. Er ist Psychotherapeut.
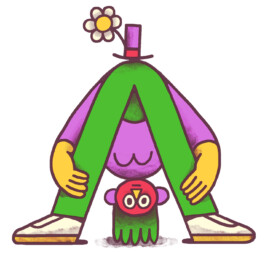
Tatsächlich gewöhne ich mich nach und nach daran, mich vor den anderen bloßzustellen. Vielleicht ist es die Nase, hinter der ich mich verstecken kann. Alles halb so schlimm, das bin ja nicht ich, das ist nur mein Clown. Oder der gesunkene Leistungsdruck – der Rest der Gruppe ist ja auch nicht lustiger. Außerdem versuche ich, mit meiner Clowns-Abneigung Frieden zu schließen, nachdem mir die anderen erzählt haben, warum sie diesen Kurs machen. Zu unserer Truppe gehört zum Beispiel eine Professorin, die schon ihr ganzes Leben lang den Wunsch hat, Clown zu sein. So richtig kann sie nicht aus ihrer Wissenschaftlerinnen-Haut: Vor dem Workshop hat sie sich Bücher zum Thema bestellt, unter anderem „Ansichten eines Clowns“ von Heinrich Böll. Ein Schauspieler und Erzieher will nach dem Tod seiner Frau sehen, ob er noch lachen kann. Eine junge Sozialwissenschaftlerin, die gerade an einer renommierten Clownsschule in der Schweiz abgelehnt wurde, möchte ihren Traum vom Clownsein einfach nicht aufgeben. Die Faszination der anderen rührt mich irgendwie.
Wäre es nicht lustig, überlege ich auf dem Weg zum letzten Workshop-Tag, als ich mit dem Fahrrad an einer Kreuzung auf Grün warte, wenn der Mann da vorn jetzt über die Straße hüpfen würde? Wir sind schon sehr versessen darauf, alles möglichst normal zu machen. Heute übt mein Kurs sich in Improvisation. Herausfordernd. Aber langsam bekomme ich sogar Spaß daran, komische Sachen zu machen und mich ungeschickt anzustellen.
Tage später wirken meine Clown-Erfahrungen nach. Mit einer Freundin sitze ich auf einem rummeligen Platz im Café und wir beobachten die Leute. Eine junge Frau läuft ungelenk auf ihren Plateau-Flip-Flops an uns vorbei. Ihre Jeans hat sie der Länge nach in vier Streifen pro Bein geschnitten, die nun wie diese Wischlappen in der Autowaschanlage um sie herumschwingen. Kein schlechtes Clownskostüm, finden wir. Ein älterer Mann trägt seine Haare exakt gescheitelt, auf der einen Seite silber, auf der anderen schwarz, dazu eine schwarz-weiß karierte Hose. Ernsthaft? Das sieht schon ziemlich lustig aus.
Meine Laune steigt – und ich bin inspiriert. Am nächsten Tag setze ich meine Clownsnase auf und eine aufgeblasene Gummikrone und gehe so vor die Tür. Natürlich komme ich mir albern vor, aber nicht im professionellen Sinne. Eine Gruppe halbstarker Skater wartet auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Tram. Ich rechne damit, dass sie sich lustig über mich machen. Doch einer von ihnen winkt mir zu. Und ein Fahrradfahrer fährt an mir vorbei, grüßt grinsend und klingelt. Toll! So eine Wirkung auf andere möchte ich immer haben. Vielleicht steckt ja doch ein Clown in mir – einer für den Alltag, nicht für die Bühne.